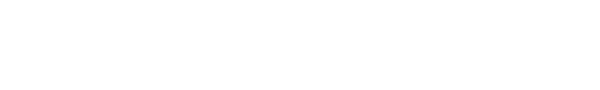Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Landsleute,
es ist mir eine Ehre, heute im Rathaus meiner Heimatstadt zu Ihnen sprechen zu dürfen. Angesichts des Ukrainekrieges mit täglich tausenden Toten, der rechtspopulistischen Entwicklungen in den USA und in der Welt, der autoritären Machtverschiebungen und hybriden Kriege müssen wir uns am 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung fragen, ob das europäische Friedensprojekt gescheitert ist. Wie können wir die liberale Demokratie schützen und verhindern, dass populistische Parteien gewählt werden, die sie abschaffen wollen? Am 15. März im Jahre 44 v. Christus wurde Julius Caesar ermordet. Nicht von seinen Feinden, sondern von seinen Freunden. Zwei Wochen vorher hatte er sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen lassen. Die Mitglieder des Senats, die an diesem politischen Mord beteiligt waren, wollten damit die römische Republik retten. Erwähnenswert ist, dass sich Julius Cäsar jahrelang mit seinen Kriegszügen dem Tribunal entzogen hatte, dass ihm wegen Verletzung der römischen Gesetze drohte. Nebenbei gesagt: Diese Methode ist auch heute mitunter erfolgreich. Cäsar hatte ganz Gallien für Rom erobert und war den Rhein entlang übers Meer bis nach Großbritannien gekommen. Aber aus heutiger Sicht war er ein Kriegsverbrecher. Glaubt man seinen „Commentarii de bello Gallico“ – früher Pflichtlektüre an allen bürgerlichen Gymnasien – wurden 430.000 germanische Usipeterer und Tenkterer von seinen Legionären getötet. Für die Genozidforschung frühes Beispiel eines Völkermords.
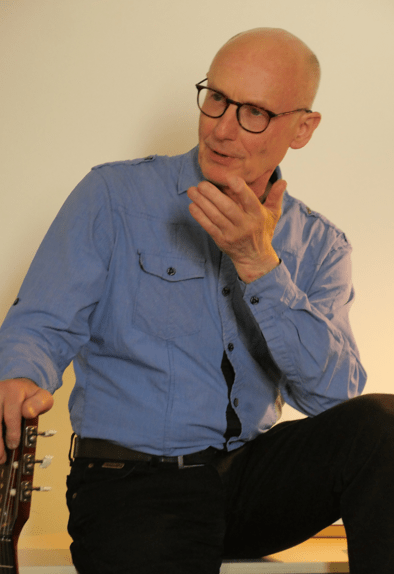
Nach der Niederschlagung von Aufständen in Gallien ließ Cäsar allen Gefangenen zur Abschreckung die Hände abschlagen. Unglaublich, dass sich die Herrscher im Heiligen Römischen Reich, in Österreich, Deutschland, Bulgarien, Serbien und Russland mit dem auf Cäsar zurück führenden Titel Kaiser oder Zar schmückten. Politische Morde an Herrschern gab es unzählige, Tyrannenmorde dagegen wenige. Attentate waren oft nicht erfolgreich. Am 9. November 1939 wollte der Schreiner Georg Elser mit der Tötung Adolf Hitlers dessen blutige Diktatur beenden und den Weg für einen europäischen Frieden ermöglichen. Er ließ sich wochenlang über Nacht im Münchener Hofbräuhaus einschließen, höhlte eine Säule neben der Rednertribüne aus und postierte dort einen Sprengsatz. Gewöhnlich erinnerte Hitler an diesem Tag mit einer stundenlangen Rede an das Ende des Ersten Weltkrieges und an seinen Putsch 1923, mit dem er die Weimarer Republik stürzen wollte. Doch ausgerechnet an jenem Tag 1939 brach er wegen eines Unwetters seine Rede nach wenigen Minuten ab. Die Bombe explodierte, Hitler blieb „dank der Vorsehung“ am Leben. Georg Elser wurde an der Grenze zur Schweiz verhaftet und nach schwerer Folter im Frühjahr 1945 hingerichtet. Auch auf Josef Stalin gab es eine Reihe von Attentaten, die alle scheiterten, er war zu gut bewacht! Ja, die Tyrannenmorde gehen nicht so schön aus wie in Schillers Ballade, in der der Attentäter begnadigt wird, weil er seinen Freund, der für ihn gebürgt hatte, nicht im Stich ließ. Drauf spricht er:
«Es ist euch gelungen, Ihr habt das Herz mir bezwungen;
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn;
So nehmet auch mich zum Genossen an.
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte“
Immer wenn ich in meine Heimat fahre, singt meine Seele. Hier habe ich eine idyllische Kindheit verlebt, bin barfuß durch die Saalewiesen gerannt, nicht achtend der Kuhfladen, und habe die Schleiereulen auf dem Kirchturm beobachtet, die nachts mit ihren sirrenden Schreien über den Pfarrhof flogen. Aber hier habe ich auch die DDR-Diktatur erleben müssen, deren Ende wir heute feiern, auch wenn die DDR formal bereits mit der Volkskammerwahl im März 1990 ein demokratischer Staat war. In der Zeit des Kirchenkampfes in den 50er Jahren wurden wir Pfarrerskinder immer mal wieder auf dem langen Schulweg von der Neuen Welt nach Schönburg verhauen. Ich erlebte als 7-jähriger die Verhaftung meines Vaters. Fast ein Jahr verbrachte er im Gefängnis, weil er sich geweigert hatte, an einer Wahl teilzunehmen, die keine war. Die kirchlich eingestellten Studienräte wurden von der erweiterten Oberschule in der Thomas-Müntzer-Straße verwiesen. Eine von ihnen, Frau Sauberzweig, bot an den Nachmittagen in den Räumen des Doms freiwillige Unterrichtsstunden an und las mit uns bei Keksen und Tee u. a. „Julius Cäsar“ von Shakespeare, im Original (!), mit der berühmten Rede des Antonius. Wir Pfarrerskinder genossen das Privileg, anders sein zu dürfen. Bei den vielen Fahnenappellen und den obligatorischen Märschen zum 1. Mai und 7. Oktober standen wir ausgesondert in schwarz-weiß neben den Blauhemden, um das einheitliche Bild nicht zu stören. Aber auch wir waren konfrontiert mit Wehrerziehung, verlogenen Zeitungen und erlebten, der Macht ausgeliefert zu sein. Jeder Volkspolizist – in Naumburg war das der berüchtigte „Stempelbauer“ – stellte als erstes klar, dass er hier die Macht hatte und wir ein Dreck waren. Drei meiner Geschwister durften kein Gymnasium besuchen, ein Grund für meine Eltern, nach der Pensionierung meines Vaters in den Westen zu übersiedeln. Nach und nach wuchs die Mauer quer durch unsere Familie. Bis zum 9. November 1989 litt ich an dem Grenzleid mehr als am politischen Druck.
Das Besondere an meiner Kindheit in Schönburg waren meine Beziehungen zu den sogenannten Russen, von denen viele in Wirklichkeit Ukrainer oder Kasachen waren. Sie waren als Mottschützeneinheiten in Naumburg und Weißenfels stationiert und hatten im Franzosental und im Schönburger Wald ihre Sommerlager und Funkstationen. Ich fand es romantisch, mit ihnen am Lagerfeuer zu sitzen, russisches Schwarzbrot zu kauen und ihre Lieder zu hören. Dadurch lernte ich Russisch und wurde später ein Experte für Russland und den Kaukasus, für die Tschetschenienkriege und für Wladimir Putin.
Mit den „Russen“ erlebte ich kuriose Geschichten. So fuhr plötzlich an einem Samstag ein dreiachsiges russisches Militärfahrzeug „Ural“ auf den Pfarrhof, das so groß war, dass es kaum wenden konnte. Die Soldaten hatten ein Fass Bier dabei, zogen ihre Stiefel aus und wickelten ihre Fußlappen ab. Ich holte die Dorfjugend und bald tanzten alle im Gemeinderaum Kasatschok, bis früh um vier bleich meine Mutter erschien und meinte, wir müssten jetzt Schluss machen und lüften, weil um 10 Uhr hier Gottesdienst sei. Ob der Geruch nach Papirosi, Knoblauch, Fußschweiß und Bier sich bis dahin verzogen hatte, wage ich nicht zu erinnern.
Meine Beziehungen zu sowjetischen Soldaten und Offizieren waren der Grund dafür, dass uns im Dezember 1971 der verbotene Dichtersänger Wolf Biermann besuchte, dem eine Reise nach Moskau untersagt worden war. Das war für mich eine Glücksstunde! Ich organisierte für ihn zwei illegale Konzerte, eines für meine komplette Abiturklasse, denen Wolf Biermann sein Poem „Deutschland – ein Wintermärchen“ vortrug und ihnen die Augen öffnete für den falschen Sozialismus in der DDR. Zum zweiten Konzert kamen Freunde und Bekannte, einschließlich der Schönburger Bürgermeisterin, und sowjetische Offiziere aus der Weißenfelser Garnison. Wolf Biermann diskutierte mit ihnen bis zum Morgengrauen, ob sich die Partei in der Stalin-Zeit geirrt habe oder nicht. Ich dolmetschte, so gut ich konnte. Wolf Biermann wurde mein wichtigster Lehrer, von ihm lernte ich alles, was das Bildungssystem der DDR verschwieg. Bis heute bin ich eng mit ihm befreundet und singe als „Singender Zeitzeuge“ seine Lieder. Seine Ausbürgerung 1976 und der Protest der Schriftsteller und Künstler führten zur Ausreise vieler in der DDR bekannten Autoren, Regisseure, Künstler und Schauspieler, unter ihnen Manfred Krug und Armin Mueller-Stahl. Das war der Beginn des Endes der DDR. Die meisten von ihnen hatten an den Sozialismus geglaubt und hielten die DDR für das bessere Deutschland. Ich wurde von der Humboldt-Universität relegiert und gründete für die jüngere Künstlergeneration nach dem Vorbild der Biermann’schen Wohnung im Berliner Prenzlauer Berg einen Literarischer Salon für unzensierte Begegnungen und Gespräche. Er wurde zu einem wichtigen Treffpunkt einer Künstlergeneration, die sich bereits 10 Jahre vor 1989 von der sozialistischen Utopie lossagte. Den Literarischen Salon gibt es bis heute mit Veranstaltungen zu den Themen Literatur, Politik, Osteuropa und DDR-Geschichte.
Die „Friedliche Revolution“, die langersehnte Öffnung der Mauer und die Wiedervereinigung habe ich als unglaubliches Glück erlebt. Endlich die Eltern besuchen zu können! Endlich in Freiheit leben und in einem Rechtsstaat! Als ich bei einer Umfrage auf der Straße gefragt wurde, was das wichtigste an der Demokratie sei, antwortete ich sofort spontan: Die Kontrolle der Macht! Die ist allerdings nur in einem Rechtsstaat möglich. Der Einigungsvertrag war ein Vertrag zwischen zwei souveränen Staaten, auch wenn darauf eine „Übernahme“ folgte, wie Ilko Kowalczuk sein Buch nannte. Freiheit bedeutet vor allem, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das war für viele DDR-Bürger neu und schwer. Es ist nicht leicht, das Heimsyndrom zu überwinden: Zwar eingesperrt, aber dafür steht täglich das Essen auf dem Tisch, ist der Tag durchnummeriert und eigenes Denken nicht gefragt.
Komme ich jetzt, 35 Jahre später, in meine Heimat, habe ich den Eindruck, es ging meinen Landsleuten noch nie so gut wie jetzt. Neu gedeckte Häuser, teure Autos auf glatten Straßen, Urlaube an den schönsten Orten der Welt. Schaue ich mir die Wahlergebnisse an, bin ich geschockt. Woher kommt diese Unzufriedenheit, der Hass auf die liberale Demokratie, auf die Bundesregierungen, auf den Staat, auf Amerika, auf die wenigen Migranten, die es in Sachsen-Anhalt gibt? Ist es wahr, dass viele meiner Landsleute wieder „Deutschland, Deutschland über alles“ denken und als Germanen übers Feuer springen? Wünschen sie tatsächlich wieder einen starken Staat, der ihnen alle Entscheidungen abnimmt? Was ist, wenn ihnen der starke Staat die eigene Meinung und den Mund verbietet? Wer soll ohne die Einwanderung von Migranten die Renten bezahlen? Alle aus Tschetschenien Geflüchtete, die ich seit Anfang der 2000er Jahre unterstützte, sind integriert, arbeiten und zahlen Steuern. Der politische Islam, dessen Anschläge wir abwehren müssen, ist nicht auf Geflüchtete angewiesen, er kann auf vielen anderen Wegen versuchen, unsere Gesellschaft zu destabilisieren.
Als ich die Biografie Walter Ulbrichts von Ilko Kowalczuk las, war ich entsetzt. Das 1922 von Lenin, Trotzki und Sinowjew entworfene Programm der Kommunistischen Internationale war genauso totalitär wie das der NSDAP. Eigentlich sollte damit die kommunistische Utopie erledigt sein. War sie aber nicht und ist sie nicht. Hitler hatte 1932 in Leipzig verkündet: wir kommen mit legalen Mitteln an die Macht und werden sie mit illegalen Mitteln ausüben. Wie eine Diktatur entsteht, erleben wir gerade in Russland: Zuerst müssen das Parlament und die Gerichte gleichgeschaltet werden, dann die Medien. Es folgt die Enteignung einflussreicher Oligarchen, dann die Eliminierung der politischen Gegner. Wladimir Putin hat eine blutige Spur durch Russland und Europa gezogen. Mit den Sprengstoffanschlägen in Moskau und Wolgadonsk, bei denen 300 russische Bürger im Schlaf getötet wurden, begann er den 2. Tschetschenienkrieg, der noch brutaler war als der erste. Ganze Ortschaften wurden ausradiert, Filtrationslager eingerichtet, systematisch foltert und gemordet. Wladimir Putin ist mehr als ein Kriegsverbrecher. Bei den Geiselnahmen in Musicaltheater Nordost und in der Schule von Besann stand der russische Geheimdienst Pate. 200 Politiker, Menschenrechtler und Journalisten wurden getötet, viele, weil sie zu viel wussten: Anna Politkowskaja, Alexander Litwinenko, Natalja Estamirowa, Boris Nemzow, Zelimkhan Changoshvili, Nawalny…..
Wer wie Putin die uneingeschränkte Macht hat, kann alles tun, was seiner Machterhaltung dient, z. B. einen Krieg führen, in dem hunderttausende Menschen sterben, der aber nicht Krieg genannt werden darf. Alle, die gegen den Krieg protestieren, werden zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, sogar ein Mann, der mit einem leeren Blatt Papier an der Straße stand, weil sich ja jeder denken könne, was auf dem leeren Plakat stehen sollte! Kurz vor Kriegsbeginn, Ende Dezember 2021, wurden in Moskau die Menschenrechtsorganisation „Memorial international“ und das Menschenrechtszentrum „Memorial“ gerichtlich verboten. Das war ein Rückfall Russlands in finsterste Zeiten und der Versuch, die russische Gesellschaft für Wladimir Putins Machtsicherung endgültig von Europa abzuspalten. Memorial wurde 1988 als erste gesellschaftliche, d.h. regierungsunabhängige Organisation, in der Sowjetunion gegründet. Gründungsvorsitzender war der Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow. Ziel der Organisation war die Aufarbeitung der Verbrechen der Stalinzeit und die Errichtung eines Denkmals für die Opfer der sowjetischen Diktatur. Inzwischen besteht Memorial aus 80 Organisationen in Russland und osteuropäischen Ländern, die ein umfangreiches Archiv von Opferkarteien, Häftlings-Erinnerungen und Samisdat-Publikationen verwalten. An den Orten der Lager wurden Gedenksteine und, wenn möglich, Gedenkstätten errichtet. Memorial verfasst Berichte zur aktuellen Menschenrechtssituation in Russland, u. a. zu Tschetschenien, und setzt sich für Konfliktlösungen ein. Bildungsprogramme richten sich gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus. Mit Memorial verbindet sich die Hoffnung auf ein rechtsstaatliches und demokratisches Russland. Seit 2022 hat die Organisation als Zukunft Memorial ihren Hauptsitz in Berlin. Als Reaktion auf den ersten Tschetschenienkrieg gründete ich nach dem Vorbild von Johannes Lepsius 1996 die Deutsch-Kaukasische Gesellschaft. Memorial ist seit 30 Jahren ihr wichtigster Partner. Sergej Kowaljow, Dissident und Mitgründer von Memorial, hatte im April 1997 die Schirmherrschaft über die Gesellschaft übernommen und war an zahlreichen politischen Gesprächen mit demokratischen tschetschenischen Politikern und Bundestagsabgeordneten beteiligt, um nach einer Friedenslösung für Tschetschenien zu suchen. Für die ehemaligen sowjetischen Dissidenten, die für Freiheit und Demokratie im Gulag saßen, ist die erneute blutige Diktatur bitter.
Die Lager, die sie zu Erinnerungsorten gestaltet hatten, wurden unter Wladimir Putin wieder eröffnet. Das Wachpersonal dient hier in der vierten Generation. Gibt es hier tatsächlich Landsleute, die Putins Trollen folgen und seinen Krieg rechtfertigen? Ich kann nur empfehlen, glaubt nicht TikTok und den Internetmedien. Vertraut nur seriösen Berichterstattern wie Sabine Adler, Gesinde Dornblüth, Michael Thumann. Es gab keine Zusicherung an Gorbatschow, dass die Nato sich nicht nach Osten ausweiten werde, weil zu diesem Zeitpunkt noch der Warschauer Pakt existierte und das folglich kein Thema war. Russland ist auch nicht von der Nato bedroht und umzingelt, dafür genügt ein Blick auf die Karte. Vor allem will die NATO Russland nicht angreifen. Es gab sogar einen Nato-Russland-Rat, die Russische Föderation war Mitglied im Programm „Partnerschaft für den Frieden“ und 2001 eröffnete Russland eine Ständige Vertretung beim NATO-Hauptquartier in Brüssel. Die Rufe „Frieden um jeden Preis“ in der Ukraine meinen Unterwerfung. Einen wirklichen Frieden gibt es nur in Freiheit und Gerechtigkeit. Vielleicht sollten wir damit den Tag der Wiedervereinigung feiern.
Ich möchte meine Rede mit einem Gedicht beenden, das in einer Zeit entstand, in der die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg sich in einer Aufbruchstimmung zu einem neuen, friedlichen und geeinten Deutschland befanden, in der zu den Schönburgfesten die Trachtengruppe “D’Auerbergler“ aus Fürth anreisten und ihren „Schuhplattler“ tanzten, die Dorfstraßen mit Girlanden geschmückt waren. Der Aufbruch endete 1961 mit dem Bau der Mauer und der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die Schönburgfeste wurden, so schien es mir, vom Staat vereinnahmt und ihre Offenheit erstickt. Nach 1989 gab es einen neuen Aufschwung u. a. mit den „Schönburger Blasmusikanten“, deren Gastspiele sie nach Spanien, Dänemark, Polen, in die USA, nach Japan und Südafrika führten! Für mich war es eine große Freude, die Einweihung der für eine Viertelmillion Euro restaurierten Böhme-Orgel in der Schönburger Kirche zu erleben. Vielleicht brauchen wir immer wieder neue Aufbrüche in der Hoffnung auf ein Leben in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit.
Hartwig Stützer:
Mei Schemburch
Uff huchen stulzen Barche,
da schtieht der alte Turm,
nich weit darvun de Karche
varlabte manchen Schturm.
De Schtraßen sin tichtch hucklig,
einunger un einan,
de Haiser dadurch bucklich,
klabn richtch an Felsen dran.
De Leite sin jemitlich
un schprachen ziehmlich breet,
un merschtens sin se friedlich
un liebn de Frehlichket.
Se tun och jarne klatsche,
sjibt och mal beeses Blut,
doch sin se fartch met tratsche,
da asses wedder jut.
De alte liebe Saale
fließ an uns dran vorbei,
dar Fachbarch übbern Tale
äs unse Loreley.
Ja, ja, ich muss schon sache
mar hun vun allen was,
mar wullen och nich klache
mal übber dies und das
Hier fihl mar uns darheeme
un allen ruf ichs zu:
In Schemburch ässes scheene,
da haste Glick un Ruh.
(1950)